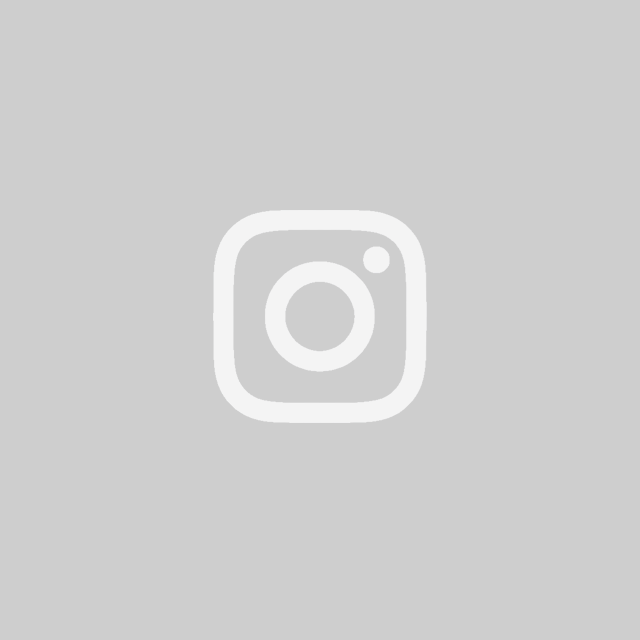Historische Anstückung an einem Gemälde oben und unten: (Mariä Heimsuchung, 16. Jh., Öl/Holz). Die angestückten Teile zeigen sich dunkler als der originale Teil des Gemäldes in der Mitte. Dieser war schon stark verdunkelt und verschmutzt als die Tafel in der damals vorgefundenen Farbigkeit ergänzt wurde. Als dann die erfolgte Firnisabnahme die originale Farbigkeit des Mittelteiles wiederherstellte, zeigten sich die Ergänzungen dunkler; Foto: Paul-Bernhard Eipper
12. Dezember 2014 / Paul-Bernhard Eipper
Big is beautiful? – Über nachträglich vergrößerte Gemälde
Beim Betrachten großer Gemälde sieht man oft recht deutlich, dass die Leinwand aus verschieden großen Einzelstücken zusammengenäht wurde. Der Grund dafür ist recht simpel: Webstühle waren einst in ihrer Größe eingeschränkt, weswegen man größere Gewebeflächen nur erreichen konnte, indem man mehrere kleine Textilstücke miteinander vernähte. Diese „Patchwork“-Leinwände sind leicht daran zu erkennen, dass die Grundierungsschicht gleichmäßig die Nähte überzieht und die Komposition über diese Einzelelemente hinweggeht.
Verfälschende Eingriffe
In der Regel wurden alle Objekte, die man in Museen sieht, bereits restauriert und dabei „verfälscht“: Manche Gemälde weisen flächige, oft interpretierende Ergänzungen auf. Besonders interessant wird es, wenn Gemälde lange nach deren Fertigstellung von Künstlern oder Restauratoren auf eine neue Bildgröße gebracht werden – etwa, um eine symmetrische Hängung mit gleichen Bildformaten zu ermöglichen oder um sie großzügiger und nicht in einem zu eng bemessenen Rahmen zu präsentieren. Ob derartige „Anstückungen“ original oder von späterer Hand durchgeführt wurden, lässt sich zumeist nur durch Stilkritik, materialtechnische Untersuchungen oder naturwissenschaftliche Analysen feststellen.
Ist ein angestücktes Gemälde weniger wert?
Heute sind wir überrascht über derartige Respektlosigkeiten gegenüber Kunstwerken, doch in zurückliegenden Jahrhunderten ging man mit Kunst zuweilen nicht besonders zimperlich um. Selbst der dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen (1770–1844) schlug von den antiken Figuren des Aegineten-Frieses in der Münchener Glyptothek Teile der originalen Skulpturen ab, um seine Ergänzungen mit möglichst geraden Ansatzstellen anzubringen. Später wurden diese Ergänzungen wieder abgenommen, und heute wird das Fragment als ehrlicher und auch „schöner“ empfunden als das „vervollständigte“ Kunstwerk.
Wir dürfen also die Summe der erfolgten Restaurierungen an einem Gemälde auch als Indiz für dessen Echtheit ansehen. Die zu verschiedenen Zeiten ausgeführten Maßnahmen spiegeln eine Geschichte der zu verschiedenen Zeiten gängigen „Restaurierungs“-Methoden wider, auch wenn diese nach heutigen Vorstellungen eher Uminterpretationen darstellen.
Text: Paul-Bernhard Eipper
Morgen im Blog: “Was nicht passt, wurde passend gemacht: Gemälde-Beschneidungen”
Schlagworte: Erzherzog Johann | Kunstvermittlung | Mittelschule Eggersdorf | Museum | Museum auf Reisen | Museum des 21. Jahrhunderts | Museum unterwegs | Museumsobjekte | Neue Galerie Graz | Spezialprogramm | Vermittlung