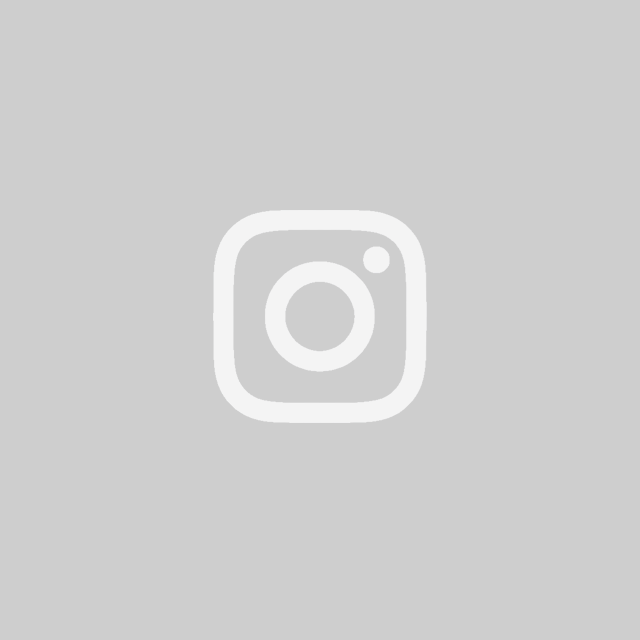Feminist protesters marched by security out of Moscow cathedral for offensive performance. Aleshkovsky Mitya / Tass / picturedesk.com
21. Dezember 2020 / Eva Tropper
Religion im Museum. Kulturelles Handeln moderieren
Wer heute Religion im Museum thematisieren will, hat sich auf ein heterogenes Publikum einzustellen: auf Vertreter*innen von Mehrheitsreligionen ebenso wie auf solche von minoritären religiösen Gemeinschaften, auf Menschen ohne religiöses Bekenntnis oder auf solche, die sich dem Thema Religion höchstens mit Skepsis und aus der Distanz nähern. Doch wie immer Besucher*innen diesbezüglich positioniert sein mögen – Religion bleibt ein gesellschaftlich virulentes und spannungsvolles Thema. Die große Chance für Museen besteht in diesem Zusammenhang darin, so etwas wie eine moderierende Rolle zu übernehmen. So können sie zu Foren für Dialog und Begegnungen werden, aber auch zu Orten, an denen Konflikte angesprochen und reflektiert werden. Denn Museen, so meinte Bazon Brocks einmal, können ungefährlich machen, was außerhalb von Museen mitunter zu Kriegen führt.
Doch welcher neuer Fragestellungen und Methoden bedarf es für ein solches Verständnis der Vermittlung von Religion im Museum? Wie können Prozesse der Öffnung auf ein heterogenes Publikum gelingen? Und inwiefern müssen gerade auch die Museumsmachenden selbst die Bereitschaft mitbringen, ihre eigene Positioniertheit im Feld der Religionen zu reflektieren? Diese Fragen bildeten den roten Faden des in Kooperation mit dem Wiener Dom Museum per Zoom durchgeführten Workshops der Museumsakademie, der von Martina Griesser-Stermscheg und mir konzipiert wurde.
Ein Paradigmenwechsel im Umgang mit Religion
Die Voraussetzungen einer interkulturell sensibilisierten Herangehensweise an Religion zeigte Peter Bräunlein, Religionswissenschaftler und Ethnologe an der Universität Göttingen, in seiner Keynote auf. Denn in der Tat hat sich der Blick auf Religion in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt – auch in den Religionswissenschaften. Es ist eine Entwicklung, die weg von einem phänomenologischen Religionsbegriff und hin zu einem kulturwissenschaftlichen geführt hat. War Religion zuvor lange als ein „Heiliges“ oder „Numinoses“ gefasst, so geht es heute immer mehr darum, Religionen als symbolische Deutungssysteme und Praktiken zu begreifen, mittels derer Menschen ihrer Welt Bedeutung verleihen.
Damit geht einher, dass sich die Religionswissenschaften stark den ‚Objekten‘ zugewandt haben, die in religiösen Praktiken und Sinnstiftungsprozessen eine Rolle spielen. Für die Frage nach Religion im Museum ist diese materielle Ebene besonders relevant, sind Objekte doch die zentrale Basis von Museumsarbeit. Museen sollten sich, so Peter Bräunlein, mit ihrer eigenen Transformationsmacht in Bezug auf Objekte auseinandersetzen. Denn im Museum werden Gegenstände, die ursprünglich in kultischen oder religiösen Zusammenhängen verwendet wurden, in museale Artefakte verwandelt und im Zuge dessen mit ganz anderen Bedeutungen aufgeladen. So begegnen uns religiöse Objekte im Museum traditionell entweder als ‚Kunst‘ oder, in volks- oder völkerkundlichen Sammlungen, als ‚Ethnographica‘.

eMuseumPlus Nischenteppich
Religiöse Artefakte neu lesen
Dass damit aber nicht nur ihre ursprünglichen Bedeutungen überschrieben, sondern auch abweichende oder kulturell differierende Lesarten unterdrückt werden, machte die Museumswissenschaftlerin Susan Kamel in ihrem Input deutlich und führte am Nachmittag des ersten Tages mit einem kleinen Workshop-Format in das Thema einer machtkritischen und diversitätssensiblen Ausstellungsanalyse ein. Dabei geht es darum, sich für eigene Bedeutungsprojektionen, Werthaltungen und Vorurteile – etwa in Bezug auf Objekte aus islamisch geprägten Ländern und diasporischen Gemeinschaften – zu sensibilisieren. Diesbezüglich ist ein Wechsel der Perspektive hilfreich. Wie sieht etwa eine junge Muslima namens Aziza, Studierende in Berlin, gläubig, aber nicht praktizierend, einen im Museum für Islamische Kunst ausgestellten Knüpfteppich? Welche Bedeutung hat er für sie? In Kleingruppen diskutierten wir, wie sehr die Perspektivenveränderung mithilfe von ‚Personas‘ dabei helfen kann, neu über die vielstimmige Bedeutung von Objekten für die Museumsbesucher*innen nachzudenken. Diese Sensibilisierung ist zugleich hilfreich, um tradierten eurozentrischen Präsentationslogiken auf die Schliche zu kommen und neu darüber nachzudenken, wie wir religiöse Artefakte vermitteln wollen.
„Wie können verengende Festschreibungen aufgebrochen und die Vielfalt alternativer Lesarten sichtbar gemacht werden – und zwar vor, in und hinter den Vitrinen?“ (Susan Kamel)
Die Frage nach dem Aufbrechen gängiger Präsentationsweisen im Zusammenhang mit Religion hatte uns schon am Vormittag desselben Tages beschäftigt, nämlich in einem virtuellen Rundgang durch das Dom Museum Wien. Das 2020 mit dem Österreichischen Museumspreis ausgezeichnete Haus beherbergt einerseits eine umfangreiche eigene Sammlung sowie Dauerleihgaben aus dem Stephansdom und aus verschiedenen Pfarren der Erzdiözese Wien (Schatzkunst rund um Rudolf den Stifter, Heiligenskulpturen, Altarbilder, liturgische Geräte und Buchmalerei). Andererseits verfügt es über eine sich ständig erweiternde Sammlung zeitgenössicher Kunst, die auf die Initiative des Dompredigers und Galeristen Otto Maurer zurückgeht. Beim Rundgang durch das Haus mit Direktorin Johanna Schwanberg ging es um unterschiedliche Strategien, wie tradierte Präsentationsweisen sensibel aufgebrochen und für unterschiedliche Lesarten geöffnet werden können.
Das Potenzial von Kunst, Dialoge anzuregen
So verzichtet die Struktur der Dauerausstellung auf eine allein christliche Kontextualisierung der versammelten liturgischen Objekte, sondern findet mit einer Gliederung in Kapitel wie „Feiern“, „Leben“ oder „Schenken“ einen übergreifenden Rahmen für ihre Präsentation. Gezielte künstlerische Interventionen wie etwa die Montage einer zeitgenössischen Arbeit mit einer historischen Monstranz triggern neue, andere Lesarten und öffnen einen Raum für Reflexion. Auch in der temporären Ausstellung Fragile Schöpfung, die auf die Verletzlichkeit der Natur im Zuge der Klimakrise referiert, geht es um die spezifischen Potenziale von Kunst, Fragen zu stellen und Dialoge anzuregen. So wird der christliche Begriff der ‚Schöpfung‘ in einen zeitgenössischen Horizont gestellt und öffnet einen Reflexionsraum, der weit über eng religiös gefasste Fragen hinausreicht.

Dom Museum, Foto: Martina Griesser-Stermschegg
Diese Öffnungsbewegung, die derzeit allerorten im Umgang mit Religion feststellbar ist, betrifft aber auch das Verständnis der jeweiligen Religionen selbst. So sind Ausstellungen und Vermittlungsprojekte aktuell stark von dem Bemühen geprägt, homogenisierende Vorstellungen von Religion („das Christentum“, „das Judentum“, „der Islam“) aufzubrechen zugunsten eines Verständnisses religiöser Praxis, die von unterschiedlichen – kollektiven ebenso wie individuellen – Faktoren geprägt ist. Denn religiöse Identifizierungen sind nur einer von vielen ‚Layern‘ von Identität, wie insbesondere im Input von Georg Traska, Kulturwissenschaftler an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, deutlich wurde. Er präsentierte die ausschließlich auf Interviews basierende Ausstellung Schulgespräche. Junge Musliminnen in Wien. In den Gesprächen, die die Schüler*innen miteinander vor der Kamera führten, wurde eine große Vielfalt von Identitäten und Zugängen zu Fragen von Religion und religiöser Praxis sichtbar. Während die mediale und politische Diskussion über „den Islam“ in der Regel zu Vereinfachungen neigt und von den immer gleichen Zuschreibungen von außen geprägt ist, war das Ausstellungsprojekt von dem Bemühen angetrieben, die damit Gemeinten selbst zu Wort kommen zu lassen und sie in Prozesse der Reflexion ihres Alltags zu verwickeln. Damit gelang es, übliche, reflexartige Erwartungshaltungen der medialen Öffentlichkeit zu untergraben und stattdessen vielschichtige alternative Lesarten anzubieten.
Mein, dein, kein Kopftuch, Volkskundemuseum Wien
https://www.volkskundemuseum.at/ausstellungen/online_ausstellungen/schulgespraeche/mein_dein_kein_kopftuch
Erwartungshaltungen enttäuschen
Dass es sich mitunter lohnt, Erwartungshaltungen zu enttäuschen, machte auch Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums Augsburg, zu ihrem Argument, Vorstellungen über „das Judentum“ zu diversifizieren. Gerade jüdische Museen kämen durch die Fülle unterschiedlicher Erwartungshaltungen bezüglich ihrer gesellschaftlichen Aufgaben leicht in eine Position der Fremdbestimmtheit: So sollen sie insbesondere Schüler*innen über die Grundlagen jüdischer Traditionen (Stichwort „das Judentum“) informieren, jüdische Geschichte – idealerweise mit lokalen Highlights – vermitteln und Instrumente gegen den ansteigenden Antisemitismus an die Hand geben. Barbara Staudinger plädierte dafür, diese Erwartungshaltungen zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie ein zeitgenössischer Umgang innerhalb einer säkularen, postmigrantischen Gesellschaft mit Fragen jüdischer Geschichte aussehen könnte. Das Setzen von Themen aus dem Heute heraus sei dabei zielführender als ein Festhalten an überkommenen Präsentationsstrategien.
„Eine Ausstellung über die jüdischen Schabbat-Gesetze war für eine Gesellschaft, in der Sonntags alle zur Kirche gingen, vielleicht noch verständlich. Aber ist sie es heute noch?“ (Barbara Staudinger)
Eine aktuelle Intervention in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Augsburg versucht derzeit, einen solchen Ansatz umzusetzen. Dafür wurden fünf Vitrinen, die ansonsten die jüdischen Lebenskreis-Feste sowie den Schabbat und die Speisegebote vorstellen, temporär umgewidmet: Unter Schlagworten wie Gemeinschaft, Familie, Wohltätigkeit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, die über einen religiösen Zusammenhang hinausgehen, werden nun anhand von Alltagsobjekten Geschichten von deren Besitzer*innen und ihren Werten erzählt. Damit schlägt die Intervention nicht nur den Bogen zu allgemein gesellschaftlichen Fragestellungen, sondern regt auch zu einer Auseinandersetzung mit der mitunter politisch instrumentalisierten Wendung „unsere Werte“ an – wird doch unter diesem Schlagwort oft gar nicht so sehr das Gemeinsame betont, sondern werden einzelne Gruppen oder Minderheiten ausgeschlossen. Welche Auseinandersetzung findet statt, wenn Besucher*innen diese sehr zeitgenössische Reflexion mit der Geschichte der jüdischen Bevölkerung zusammenbringen?
„Gelebte Religion ‒ Lived Religion“
Im letzten Beitrag des Workshops schließlich stellte Randi Marselis, Associate Professor in Cultural Encounters an der Universität Roskilde, noch einmal eine Reihe von methodischen Fragen und brachte den Begriff der ‚Lived Religion‘ ins Spiel – ein Begriff, der für unterschiedliche bereits diskutierte Projekte des Workshops anschlussfähig erscheint. Das Konzept der ‚gelebten Religion‘, das die persönliche Ebene religiöser Praktiken und Erfahrungen adressiert, ist die gemeinsame Klammer eines Projekts, das als Kooperation zwischen Museen und Universitäten in der dänischen Stadt Roskilde angesiedelt ist. Das Besondere an dem Projekt ist die enge Verzahnung von Forschungsansätzen aus Ethnografie und Memory Studies mit einem museologischen Nachdenken über neue Formen der Vermittlung von Religion. Randi Marselis und ihr Team fokussieren dabei vor allem auf den Kontext Stadt – in dem Fall von Roskilde – als Kontaktzone unterschiedlicher Religionsverständnisse und religiöser bzw. areligiöser Praktiken. Dabei arbeitet das Team mit experimentellen Zugängen im öffentlichen Raum ebenso wie mit Studierenden. Ziel ist dabei, Menschen auf ihre persönliche Erfahrungsebene von Religion anzusprechen, sie zum Erzählen anzuregen – und die heterogenen Ergebnisse solcher Gespräche zu sammeln und ihrerseits ins Museum zu bringen.
„Our experiments are inspired by methods from ethnography and memory studies: Sensory ethnography and walking interviews“ (Randi Marselis)
Mit Ansätzen aus der sogenannten „Sensorischen Ethnografie“ und der Gedächtnisforschung werden Räume und Objekte genutzt, um Erinnerungen anzustoßen: „Pop-up-Interviews“ im Stadtraum etwa, bei denen der Weg von den Interviewten gewählt wird und das Sprechen-im-Gehen entlang religiös codierter Umgebungen zur Methode wird. Oder auch das Arbeiten mit einer Palette historischer Fotografien, etwa der Domkirche von Roskilde. Über die Fragen „Welches dieser Fotos spricht Sie an? Was bedeutet die Kathedrale für Sie persönlich?“ können Gesprächsanlässe entstehen, die den gelebten Bezug zu Religion auf ganz spezifische Weise treffen.

Memory-Workshop, Foto: Lise Paulsen Galal
Gemeinsam mit Studierenden wurden zudem sogenannte ‚Memory-Workshops‘ durchgeführt. Dabei wurden die Studierenden gebeten, ein Objekt mitzubringen, das für sie entweder mit Religion oder mit Migration zu tun hat. Im Gespräch darüber wurden die Bedeutungen, die diese Dinge für sie persönlich hatten, sichtbar – und diskutierbar. Ziel war es, „to open up objects – for different stories“: Ein Zugang, den wir auf ähnliche Weise bereits am Vortag mit Susan Kamel diskutiert hatten und der einem gemeinsamen Trend entspricht, die Vielschichtigkeit der Bedeutung von Objekten auf neue Weise sichtbar zu machen. So werden Randi Marselis und ihr Team nicht nur die Objekte selbst, sondern auch die Ergebnisse der methodischen Experimente, das heißt den um sie herum gelagerten gesellschaftlichen Diskurs, zum Gegenstand einer Ausstellung machen, um so das heterogene religiöse Leben von Roskilde auf eine neue, wiederum zum Diskurs anregende Weise abzubilden.
Ein gemeinsamer Blick auf die Heterogenität religiöser Praxis
Es war spannend zu sehen, dass quer durch die vorgestellten Projekte zahlreiche gemeinsame Trends zu beobachten waren. Ist es einerseits ein neuer Umgang mit religiösen Artefakten und deren vielstimmigen Bedeutungen, so ist es andererseits und verknüpft damit die Suche nach neuen Formaten, nach beteiligenden Zugängen der Vermittlung von Religion und nach Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch wurde in allen Beiträgen deutlich, wie sehr das Workshopthema heute enge Fragen von Religion und Religiosität übersteigt – hin zu Fragen interkultureller Kommunikation und Verständigung. Gerade deshalb ist jenes Bemühen um Diversifizierung so wichtig, das die Beiträge des Workshops wie ein roter Faden verband.
Den definitiven Abschluss der digital durchgeführten Veranstaltung bildete schließlich ein Angebot im Stadtraum für jene Teilnehmer*innen, die in Wien anwesend waren: Mit Jens Wietschorke, Kulturwissenschaftler an den Universitäten Wien und München, spazierten wir vom Dom Museum zur Votivkirche, um den Einschreibungen von Religion in den öffentlichen Raum und in den Kirchenraum – als Ausdrucksmedium des politischen Katholizismus – nachzugehen. Dass die Votivkirche ausgerechnet in diesen Tagen von Studierenden der Uni Wien genutzt wurde, die coronabedingt die nahe gelegenen Lesesäle der Universität in den Kirchenraum erweiterten, spannte auf überraschende Weise einen Bogen zum Thema unseres Workshops. Denn es machte deutlich, wie sich ein religiöser Raum den profanen Herausforderungen der Gegenwart öffnen kann – und somit wieder zu einer Kontaktzone und einem Handlungsraum wird.

Votivkirche, Foto: Eva Tropper
Schlagworte: Ehnologie | Ethnografie | Joanneum | Judentum | Museum | Museumsakademie | Religion | Religionswissenschaft | Vermittlung