Kulturgeschichte Online bietet einen Einblick in die Geschichte und Gesellschaft der Steiermark aus immer neuen Perspektiven und im Wandel der Zeit.
Kulturgeschichte Online

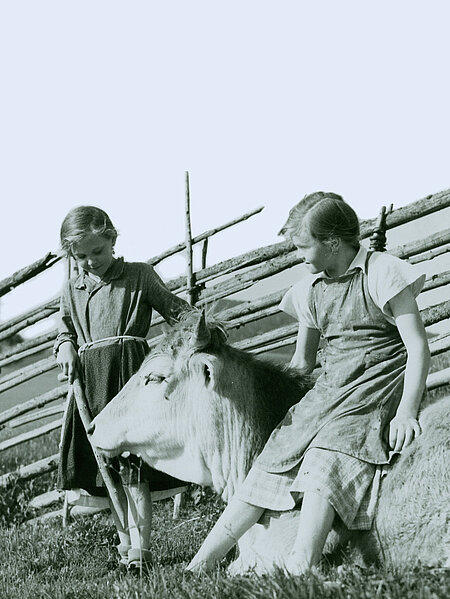
Bildinformationen

Der Nationalsozialismus in der Steiermark
Beitrag von Heribert Macher-Kroisenbrunner
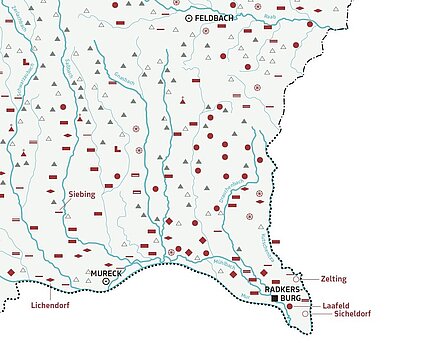
Mittelalterliche Dörfer
Beitrag von Walter Feldbacher
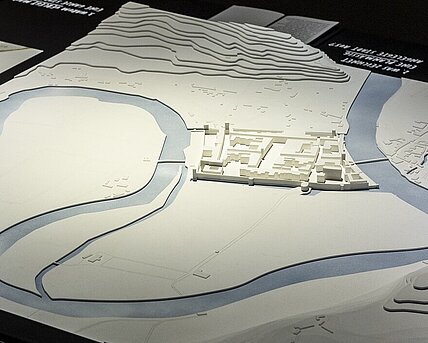
Märkte und Städte im Mittelalter
Beitrag von Michael Leitgeb

Kirchen und Klöster im Mittelalter
Beitrag von Ulrich Becker
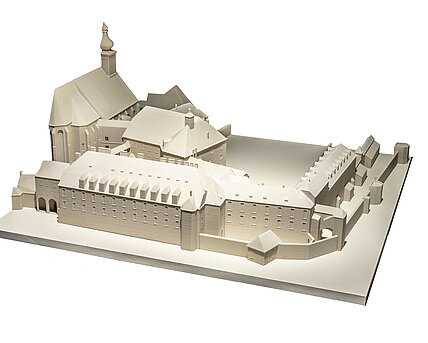
Die Grazer Burg
Beitrag von Ulrich Becker
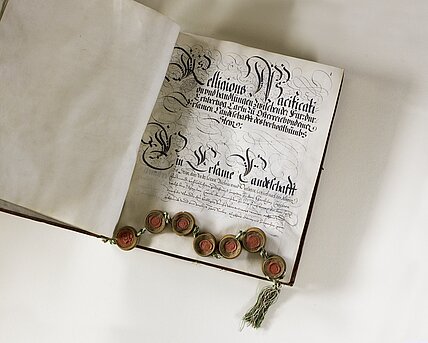
Die Reformation
Beitrag von Ulrich Becker
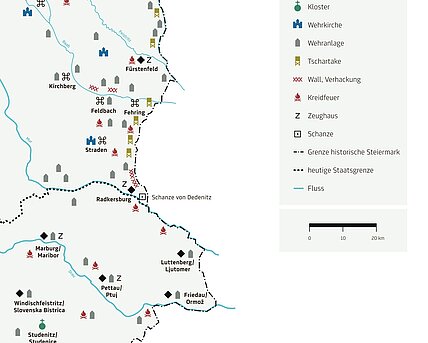
Krisen und Konflikte in der Neuzeit
Beitrag von Bettina Habsburg-Lothringen und Leopold Toifl

Der Blick in die Ferne
Beitrag von Ulrich Becker

Vorindustrielle Produktion
Beitrag von Astrid Aschacher

Peter Rosegger und seine Zeit
Beitrag von Astrid Aschacher

Das erste Warenhaus der Steiermark
Beitrag von Bettina Habsburg-Lothringen

Mutige Frauen. Hebammen im 19. Jahrhundert
Beitrag von Petra Greef
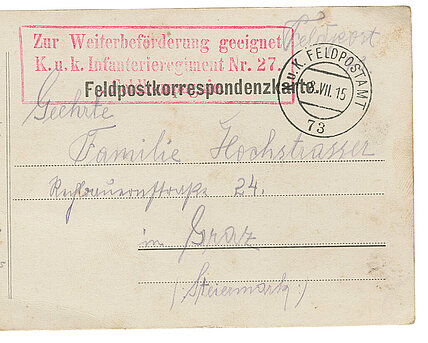
Die Steiermark und der Erste Weltkrieg
Beitrag von Helmut Konrad
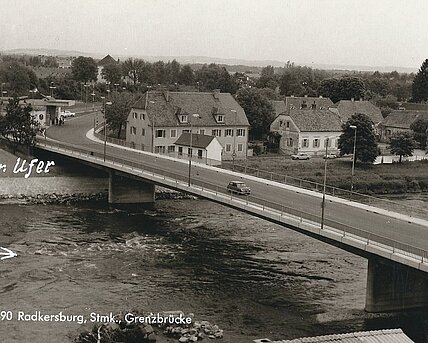
Die Grenze im Süden
Beitrag von Helmut Konrad und Petra Greeff
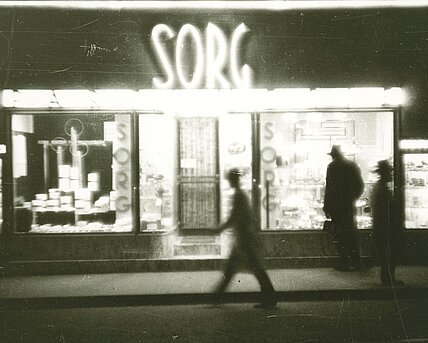
Die Steiermark bei Nacht
Beitrag von Christoph Pietrucha

Bild von einem Land
Beitrag von Bettina Habsburg-Lothringen

Steirische Wirtschaftsgeschichten
Beitrag von Walter Feldbacher
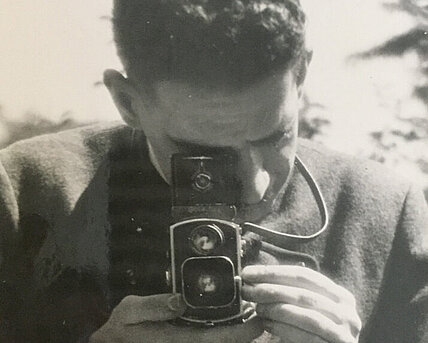
Amateurfotografien des Grazers Uto Laur
Beitrag von Heimo Hofgartner
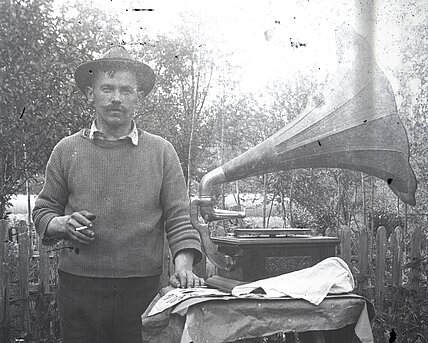
Populäre Musik in der Steiermark (1900–2000)
Beitrag von Maria Froihofer, David Reumüller, Karl Wratschko

Die Steiermark geht baden!
Beitrag von Astrid Aschacher
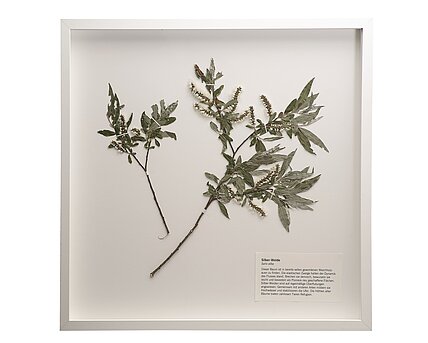
Die Mur. Eine Kulturgeschichte
Beitrag von Bettina Habsburg-Lothringen

Graz – ein Streifzug durch die Landeshauptstadt
Beitrag von Gerhard Dienes



















