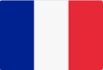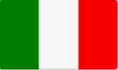Bitte beachten Sie unsere Winterschließzeiten!
Landschaftsmuseum
Dauerausstellung


Bildinformationen
Ort
Schloss Trautenfels
Alle anzeigen
Landschaftsmuseum
Wald und Holz, Berg und Tal, Glaube und Geselligkeit – die Natur- und Kulturgeschichte des steirischen Ennstales, des Paltentales und des Ausseerlandes steht im Mittelpunkt der Dauerausstellung in Schloss Trautenfels, das auch durch seine qualitätsvolle Barockausstattung und seine unvergessliche Aussicht auf die umgebende Bergwelt fasziniert!
Der Wunsch, die Natur- und Kulturgeschichte der Region umfassend darzustellen, ließ in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts in Schloss Trautenfels ein Museum für das steirische Ennstal und Salzkammergut entstehen. Nach einer Generalsanierung anlässlich der Landesausstellung 1992 präsentiert sich nicht nur das Landschaftsmuseum in völlig neuer Form, auch das Schloss erstrahlt in neuer Pracht; moderne architektonische Elemente überraschen inmitten der historischen Bausubstanz.
Neben dem prunkvollen Marmorsaal und einem stimmungsvollen Gewölberaum mit erst vor wenigen Jahren entdeckten Fresken aus dem 16. Jahrhundert erwarten Sie zwölf Räume mit zentralen Themen aus der Natur- und Kulturgeschichte der Region.
Erfahren Sie mehr über die Dauerausstellung in Ihrer Sprache!
Hier finden Sie Inhalte in verschiedenen Sprachen.
Ausstellungsrundgang
Das Landschaftsmuseum erzählt in 13 kaleidoskopartig angeordneten Räumen von der Kultur- und Naturgeschichte des Bezirkes Liezen, dem mit 3.315 km² Fläche größtem Bezirk Österreichs.
Begleiten Sie uns!
Jeder Themenraum ist einem besonderen Schwerpunkt gewidmet, der die Region und die Sammlung des Museums betreffend Objekte aus den Bereichen Kultur, Mensch und Natur vereint. Ausblicke in die Landschaft ermöglichen inhaltliche Verbindungen zwischen innen und außen.

Bildinformationen