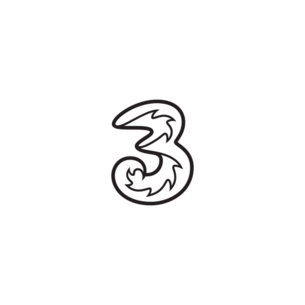Klimawandel, Kriege, politische Umbrüche – wir leben in einer Zeit wachsender Unsicherheit. Die Ausstellung Unseen Futures to Come fragt, wie wir damit umgehen und welchen Sinn wir darin finden können.
Unseen Futures to Come. Fall

Bildinformationen
Wie finden wir Orientierung in einer Welt voller Krisen?
Der Philosoph Federico Campagna spricht über unser Weltverständnis im Wandel der Zeit. Anhand einer symbolischen Bibliothek, die den Rhythmus der Jahreszeiten aufgreift, zeigt er, wie sich unsere Sicht auf die Realität immer wieder verändert – je nach Epoche, Denkweise und Erfahrung.
Dana Awartani . Federico Campagna . Christoph Grill . Adelita Husni Bey . Marija Marković . Vladimir Nikolić . Yhonnie Scarce . Andrej Škufca . Jože Tisnikar . Sophie Utikal . Bill Viola . zweintopf
Alle anzeigen
Werke in der Ausstellung

Bildinformationen
Dana Awartani
I went away and forgot you. A while ago I remembered. I remembered I’d forgotten you. I was dreaming, 2017, Mixed-Media-Installation
Über mehrere Tage hat Dana Awartani in einem Haus in Djiddah in mühevoller Handarbeit ein makelloses geometrisches Bodenmuster aus Sand geschaffen. Das Video zeigt, wie sie innerhalb weniger Minuten das Werk nun sehr bewusst wieder wegfegt. Die Zerstörung des Kunstwerks kommentiert den rücksichtslosen Umgang einer nach Moderne strebenden Gesellschaft mit ihrem kulturellem Erbe und Identität. Der langsame, fast meditative Akt der Zerstörung gibt uns Zeit, das eigene Handeln zu reflektieren.
Der Sand wurde von der saudi-arabisch-palästinensischen Künstlerin mit natürlichen, lokal gewonnenen Pigmenten gefärbt, das Muster ist traditionellen islamischen Bodenfliesen nachempfunden. Deren geometrische Muster waren früher typisch für arabische Häuser. Awartani streute das Werk auf den Boden eines verlassenen Wohnhauses in Al-Balad, der Altstadt von Djiddah, wo die Generation ihrer Großeltern gelebt hat. Als eines der ersten im „Europäischen Stil“ errichteten Gebäude steht es stellvertretend für den Wandel von der traditionellen Hejazi-Architektur, die sich über Jahrhunderte aus den regionalen Materialien und klimatischen Gegebenheiten entwickelt hat, zu einer westlich geprägten Bauweise. Durch den zunehmenden westlichen Einfluss entwickelte sich in den 1950er- und 1960er-Jahren in den gesellschaftlichen Eliten der arabischen Welt ein starkes Bedürfnis nach Modernisierung. Als „entwickelt“ und „zivilisiert“ galt, was westlich war, während die eigene kulturelle Identität fast vollständig aufgegeben wurde.
In der Dualität von Schöpfung und Zerstörung der fragilen und ephemeren Sandarbeit möchte Awartani wie in vielen ihrer Arbeiten das Bewusstsein für den Erhalt und die Wertschätzung des eigenen kulturellen Erbes schärfen – nicht als Angriff auf die Moderne, sondern als Vision eines gleichberechtigten Nebeneinanders von Altem und Neuem, Vergangenheit und Gegenwart. In Malerei, Skulptur, Performance und Multimedia-Installationen verbindet sie ein zeitgenössisches Kulturverständnis mit der Nachhaltigkeit handwerklicher Techniken und lokaler Materialien, oft in Form reinterpretierter geometrischer Muster, die auf die harmonische Symbiose von Mathematik, Natur, Spiritualität und Schönheit in der islamischen Kunst verweisen. Dieser Wunsch nach Koexistenz spiegelt sich auch im Titel der Arbeit wider, der einem Gedicht von Mahmoud Darwish entstammt. Der zeitgenössische palästinensische Dichter setzte sich in seinem Werk mit Exil und Enteignung, Verlust und Trauer auseinander, verweigerte sich dabei aber jeder nationalistischen Identitätskonstruktion – zugunsten einer lebensbejahenden Gleichzeitigkeit von Schönheit und Melancholie, auch unter schwierigsten Umständen.
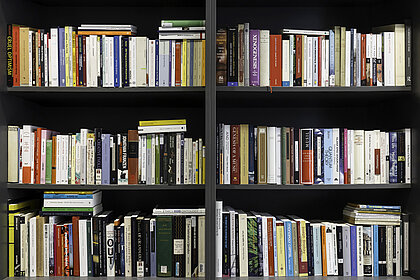
Bildinformationen
Federico Campagna
Fall: A Library of Twilight Worlds, 2025, 250 Bücher
Der Philosoph und Schriftsteller Federico Campagna beschäftigt sich mit metaphysischen Fragen und ethischen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Er erkundet, wie wir Realität erdenken und konstruieren, und stellt die technische Wahrnehmung einer kreativen Dimension des Denkens gegenüber. Außerdem beteiligt er sich an Debatten über die Begrenzungen der Moderne, der Sinnkrise und den philosophischen Möglichkeiten für alternative Zukunftsvarianten.
Für diese Ausstellung erdachte er eine Bibliothek mit dem Titel Fall: A Library of Twilight Worlds. Die Bibliothek ist eine Sammlung von 250 theoretischen und philosophischen Büchern, die rund um die Metapher der Jahreszeiten strukturiert ist, welche unseren Zugang zur Welt und unsere Wahrnehmung derselben symbolisieren. Er konzentriert sich auf den Herbst (Fall) und interpretiert diesen als jene Jahreszeit, in der sich Gewissheit auflöst, Wissen infrage gestellt wird und die Angst vor dem Unbekannten stärker wird. Hier trifft rationales Denken auf alternative Weltanschauungen – wissenschaftliche Texte stehen neben okkulten und esoterischen Schriften, was das komplizierte Zusammenspiel zwischen Vernunft und Unsicherheit in Zeiten der Veränderung unterstreicht.
Campagna stellt fest: „In den meisten Fällen jedoch steht, sobald der alte Bezugsrahmen zu bröckeln beginnt, ein neuer bereit, um seinen Platz einzunehmen. Der Moment des Übergangs zwischen beiden ist immer beunruhigend, aber der damit einhergehende Schock hat in der Regel mehr mit den schwierigen Anpassungen zu tun, die wir an den Figuren vornehmen müssen, als mit dem Blick auf die leere Kulisse hinter ihnen.“[1]

Bildinformationen
Christoph Grill
The Roar of the Sea and the Darkness, 2025
Wirklich und unwirklich zugleich wirken die einsamen Orte an der nächtlichen Küste des Ochotskischen Meeres, einer abgelegenen arktischen Region im Osten Sibiriens. Fremde, raue Landschaften, melancholisch und auf den ersten Blick nicht zum Verweilen einladend.
Der Fotograf und Archäozoologe Christoph Grill erforscht in seinen Fotografien die Bedeutungsschichten solcher natürlichen und anthropogenen Landschaften. Er untersucht, wie sich in ihnen Spuren von Geschehenem einschreiben und überlagern. Er bereist die Landschaften mit einer großen Offenheit für Geschichten und Begegnungen, lässt sich vom Gefundenen leiten. Diese Herangehensweise spiegelt sich in seinen Bildern wider, die unseren Blick nicht lenken, sondern einladen, ihn schweifen zu lassen; sich in ihnen auf die Suche zu begeben, zu entdecken, über scheinbar Nebensächliches zu stolpern. So zeigt Grill – ganz im Sinne Susan Sontags – ohne zu interpretieren, was er sieht, was als Bild schon da ist.
Andererseits setzt er sich jedoch intensiv mit dem auseinander, womit die fotografierten Landschaften inhaltlich aufgeladen sind. So führt er uns in diesen Fotos, die während zehn Jahren entstanden, in denen er die Nachfolgestaaten der Sowjetunion bereiste, in kontaminierte Landschaften. Er untersucht „Störzonen politischer Ideologien und des kapitalistischen Extraktivismus“ (Astrid Kury) und findet in ihnen Ausgangspunkte gesellschaftspolitischer, ökologischer und existenzieller Fragestellungen. Er bleibt aber nicht im Dystopischen, sondern zeigt die Verletzlichkeit und Widerstandsfähigkeit von Mensch wie Natur. Der Titel der Serie ist einem Gedichtzyklus des britischen Schriftstellers Malcolm Lowry, der sich in seinen Texten oft mit der Suche nach Identität und den Verlockungen der Ferne auseinandersetzt, entliehen und unterstreicht diesen produktiven Widerspruch in Grills Arbeit.
In – eigentlich unsentimentalen – Bildern lässt er poetische, aber ambivalente, zeitlose Sehnsuchtsorte entstehen. Christoph Grill reproduziert dabei keine stereotypen Motive oder illustriert bekannte Narrationen, sondern macht Andeutungen. Er lenkt unseren Blick auf Beiläufiges statt Wiedererkennbares, irritiert anstatt zu erklären und lässt uns so in der eigenen Vorstellungskraft Geschichten zusammenfügen, die sich vielleicht zugetragen haben könnten – oder auch nicht.

Bildinformationen
Adelita Husni Bey
Briganti, 2023, Print
I Briganti sind ein antifaschistischer und antirassistischer Rugby-Club in Librino, einem Stadtteil von Catania auf Sizilien. Der Vorort wurde in den 1970er-Jahren im Rahmen der Gentrifizierung des Stadtzentrums errichtet und leidet seit Jahrzehnten unter institutioneller Vernachlässigung. Der Verein I Briganti begann 2006 die Jugendlichen von Librino in Rugby zu trainieren und besetzte 2012 den damals leerstehenden Sportkomplex San Teodoro.
Angriff und Verteidigung, Territorium, Antifaschismus. Diese Begriffe – und wie sie sich in das Territorium, in dem die Mitglieder der weiblichen Rugby-Nachwuchsmannschaft des Vereins leben, einschreiben und diese prägen – sind der Ausgangspunkt der Fotografien der libysch-italienischen Künstlerin und Pädagogin Adelita Husni Bey. In prozessbasierten Arbeiten zeichnet sie Analysen gemeinsamer sozialer Realitäten nach, die in kollaborativen, auf ganzheitlicher Pädagogik basierenden Workshops mit unterschiedlichen Teilnehmer*innen erarbeitet werden. Ihr Fokus auf das Kollektive steht bewusst im Gegensatz zu der gesteigerten Individualität und Vereinzelung im Kapitalismus und hinterfragt auch die „Währung“ der Autor*innenschaft.
Für Briganti lud sie das Team ein, sich in einem Image Theatre-Workshop mit dessen Geschichte im soziopolitischen Kontext von Librino auseinanderzusetzen. Basierend auf Gesprächen und Interviews über mehrere Monate entstanden die Fotografien in zwei intensiven Workshops. Die Teilnehmerinnen formen nach einer kurzen Diskussion über einen Begriff Stück für Stück ein Bild. Ohne sich abzusprechen oder zu planen, betreten sie nacheinander den vorher definierten Bildraum und positionieren sich dort. Instinktiv und inspiriert von jenen, die vor ihnen eingetreten und sich positioniert haben, finden sie ihren Platz, nehmen ihre Rolle im Bild ein. Nachdem Husni Bey das so entstandene tableau vivant (lebendes Bild) festgehalten hat, wird besprochen, wie sich Ereignisse und Erinnerungen im individuellen und kollektiven Körper ausgedrückt haben.
Wie funktioniert Angriff im Rugby? Und wie manifestierte er sich in der sozialen Realität, in der der Verein mehrfach von rechtsextremen Gruppen angegriffen wurde? Was verteidigen wir, wenn wir in der Sporthalle bleiben, um Brandanschläge zu verhindern? Bleiben wir im Viertel, auch wenn viele andere gehen und auch wir diesen Wunsch verspüren? In der künstlerischen und sozialen/pädagogischen Arbeit von Husni Bey werden komplexe soziale Zusammenhänge und die eigene Verflochtenheit in sie nachvollziehbar – für uns Betrachter*innen genauso wie für die Protagonistinnen.
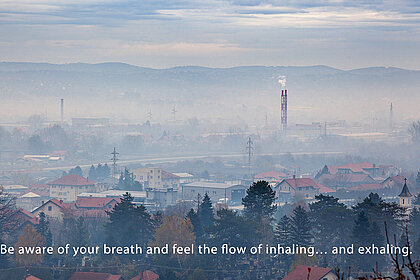
Bildinformationen
Marija Marković
I Want You to Panic, 2021, Video
120 Schläge pro Minute ist die minimale Herzfrequenz während einer Panikattacke. 120 Bilder der verheerenden ökologischen Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Erde zeigt uns auch Marija Marković pro Minute. Die Bilder stammen von Aktivist*innen, die sie in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung in ganz Serbien sammelten. Nur scheinbar bricht die ruhige Stimme aus dem Off die atemlose Hektik der schnellen Bildfolge. Sie leitet uns durch eine Übung, die bei einer Panikattacke dabei helfen soll, die eigene Atmung zu kontrollieren und ein Gefühl von Sicherheit zurückzugewinnen.
Die Künstlerin und Aktivistin untersucht in ihren Arbeiten in verschiedenen Medien, wie wir mit den Krisen unserer Zeit umgehen, und möchte vor allem das Bewusstsein für ökologische Probleme und deren Dringlichkeit stärken. In ihren jüngsten Arbeiten erforscht sie die sozialen, physischen und mentalen Auswirkungen der Klimakatastrophe. Diese selbst, ihre Auswirkungen und die scheinbare Hilflosigkeit, mit der wir ihr als Individuen gegenüberstehen, kann Gefühle der Angst und Panik auslösen. Unser ausufernder Konsum im nahezu unkontrollierten globalen Neoliberalismus überdehnt die natürlichen Grenzen des Planeten immer mehr. Die Luft, die wir atmen, wird zunehmend dünner. Wem gehört diese Luft, die wir verschmutzen, wem der Lebensraum, den wir zerstören? Marković sieht den unauflösbaren Widerspruch zwischen ungezügeltem Individualismus und der Notwendigkeit einer generationenübergreifenden gesellschaftlichen Verantwortung immer deutlich zutage treten. Privatwirtschaftliche Maximierung des Profits für einige wenige und Steigerung des Komforts für eine relativ kleine Gruppe unterlaufen die gesellschaftlichen Anstrengungen, mit den vorhandenen Ressourcen nachhaltig umzugehen. Von allen Seiten werden wir beruhigt (dass bald und ausreichend gehandelt werden würde) und ertappen uns dabei, uns selbst zu beruhigen (dass es schon nicht so schlimm werden würde). Aber hilft uns diese Ruhe, um innerhalb einer neoliberalen Konsumgesellschaft verantwortungsvoll zu handeln, oder ist es vielmehr eine trügerische Ruhe, die dazu beiträgt, uns einzulullen, uns politisch passiver werden zu lassen?
Den Titel der Arbeit entlehnte Marković von der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Diese forderte 2019 in ihrer Rede im europäischen Parlament: „Ich möchte, dass ihr in Panik geratet. Ich möchte, dass ihr euch so verhaltet, als würde euer Haus brennen.“ Ein deutlicher, fast verzweifelter Aufruf der nächsten Generation, endlich zu handeln.

Bildinformationen
Vladimir Nikolić
800m, 2019, Ein-Kanal-4K-Video
Vladimir Nikolić ist ein Künstler, dessen Werk oft die kulturellen und ideologischen Veränderungen in der zeitgenössischen Gesellschaft anspricht. Es erforscht, wie Verschiebungen von Technologie, Bilderzeugung und die sich ständig weiterentwickelnde Rolle der Kunst geformt und umgeformt werden. Kern seiner Praxis ist ein kontinuierliches Interesse an den Mechanismen menschlicher Wahrnehmung. Wie Nikolić in einem Interview sagte, „ist Wahrnehmung nicht eine Widerspiegelung der Realität, sondern eine Interpretation davon“. Für ihn spielt Technologie eine entscheidende Rolle in der Art und Weise, wie Realität konstruiert wird: nicht einfach als neutrales Werkzeug, sondern als aktive Gestalterin der visuellen Erfahrung.
Dieser konzeptuelle Rahmen wird auch in seinem Werk 800m realisiert. Es war Teil des serbischen Beitrags bei der 59. Biennale in Venedig, genannt Walking With Water. Die Installation widerspiegelt Nikolićs kontinuierliches Interesse am Zusammenhang zwischen Bild, Illusion und Interpretation sowie an den subtilen Arten, wie Technologie unser Weltverständnis konditioniert.
Das Vermischen von Technologie mit unserer Sichtweise der Welt und gleichzeitig der Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen, schlägt sich in der Wahl des Mediums und der Präsentationsweise des Werkes nieder.
Das Porträt-Format des Videos täuscht zunächst, da es aus der Ferne so aussieht, als ob man ein abstraktes, minimalistisches Gemälde betrachtet. Erst wenn man näherkommt, merkt man allmählich, dass sich das Bild bewegt. Man kann eine schwimmende Person erkennen, die im Vergleich zur Größe des Bildschirms die Distanz eines Swimmingpools zurücklegt.
Der Titel 800m entstand, als der ursprüngliche Plan des Künstlers, 1.000 Meter zu schwimmen, scheiterte, da die Speicherkarte während des Filmens voll wurde und statt der geplanten Distanz nur 800 geschwommene Meter aufgenommen wurden. Dieses Spiel mit unserer Wahrnehmung verdeutlicht das fundamentale Interesse des Künstlers an Bildern, die er nicht für selbstverständlich erachtet und die von äußeren Umständen beeinflusst werden.
Schließlich steht 800m auch für Nikolićs breitere Untersuchung der Art und Weise, wie Bilder produziert, aufgenommen und kontextualisiert werden. Er fordert uns heraus, das, was wir sehen, nicht für bare Münze zu nehmen, sondern zu überlegen, wie tief unsere Wahrnehmung vermittelt, gefiltert und gerahmt wird – nicht nur durch Technologie, sondern auch durch kulturelle und konzeptuelle Filter, die wir beim Prozess des Betrachtens anwenden.

Bildinformationen
Yhonnie Scarce
Operation Buffalo, 2024, Installation
Die australische Künstlerin Yhonnie Scarce ist eine Nachfahrin der Kokatha- und Nukunu-Völker. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit dem Trauma und den Auswirkungen der kolonialen Vergangenheit Australiens, speziell mit der Vertreibung, der kulturellen Auslöschung und den systemischen Ungerechtigkeiten, denen die Aborigines ausgesetzt waren. Sie arbeitet primär mit Glas, das in ihrem Werk symbolisches Gewicht hat. Glas entsteht durch einen Prozess, bei dem Quarzsand extremer Hitze ausgesetzt wird.
Scarce schafft handgefertigte Objekte und Skulpturen aus Glas. In großen, räumlichen Installationen wie der ausgestellten Operation Buffalo thematisiert sie die nuklearen Tests, die Großbritannien in den 1950ern in Australien durchgeführt hat. Diese Tests fanden auf einem Territorium statt, das den Ureinwohner*innen Australiens gehörte. Diese wurden gewaltsam umgesiedelt, was die Zerstörung ihrer Kultur beschleunigte. Der radioaktive Niederschlag und die Strahlung breiteten sich allerdings viel weiter aus als geplant, wodurch viele Menschen der Strahlung ausgesetzt waren, darunter auch diejenigen, die an den Tests mitgearbeitet hatten, und die Anwohner*innen der Testgelände. Sowohl Veteranen als auch Aborigines starben schon in jungen Jahren an Krebs und Leukämie und auch ihre Nachkommen litten an den Konsequenzen. Das Testgebiet selbst war über 30 Jahre lang nicht zugänglich. Berichte über die Auswirkungen der Atomtests in der Region auf Menschen, Tiere und Umwelt gehen weit auseinander und erst in den 1980ern begann man, das tatsächliche Ausmaß der Verseuchung zu erkennen. Der lange Kampf um Aufräumarbeiten, Anerkennung und Reparationen hat diese Ungerechtigkeiten bisher nur teilweise adressiert.
Die Installation Operation Buffalo besteht aus 1.300 Glasobjekten, die australischen Süßkartoffeln – Yams – ähneln, einem traditionellen australischen Grundnahrungsmittel. Sie ist sowohl Mahnmal und Warnung als auch ein Tribut an die menschliche Widerstandsfähigkeit. Sie verdeutlicht die tiefen Narben, die der atomare Kolonialismus hinterlassen hat, und fordert kontinuierliche Wachsamkeit ein, um die Wiederholung solcher Gewalt zu verhindern. Durch das Medium Glas – schön und zerbrechlich zugleich – eröffnet Scarce eine starke, aber auch poetische Konfrontation mit der verschwiegenen Geschichte Australiens.
Das Projekt der Künstlerin Yhonnie Scarce konnte mit Unterstützung der Australischen Botschaft gezeigt werden.

Bildinformationen
Andrej Škufca
Black Market: 6GB ending, 2020
Andrej Škufcas künstlerische Praxis befasst sich mit spekulativen Zukunftsperspektiven, vor allem jenen, die zum Nachdenken über postmenschliche oder techno-organische Hybrid-Systeme oder Einheiten einladen. Im Hinblick auf die Schwierigkeit, konkrete Zukunftsprojektionen zu artikulieren, bedient sich Škufca assoziativer Techniken und Referenzen, die verschiedene mögliche Szenarien nur andeuten.
Die Skulptur 6GB ending ist Teil einer umfassenderen Serie Škufcas mit dem Titel Black Market. Traditionell bezieht sich der Begriff „black market“ (Schwarzmarkt) auf ein inoffizielles Wirtschaftssystem, das außerhalb legaler Strukturen existiert und oft in Krisenzeiten oder Perioden des systemischen Zusammenbruchs floriert. Im Zusammenhang mit dem Hochkapitalismus der heutigen Zeit erlangt diese Metapher neue Bedeutung. Der Markt ist nicht mehr bloß ein wirtschaftliches System, sondern ein allumfassender Mechanismus, der die Beziehungen zwischen Menschen, anderen Arten und der Natur definiert. In seiner extremsten Form erschöpft Kapitalismus alle Ressourcen, sowohl menschlicher, biologischer und ökologischer Natur, um maximalen Profit zu erreichen. Angesichts dieses totalisierenden Marktes stellt sich die Frage, ob es im begrifflichen Sinn überhaupt noch einen Unterschied zwischen dem Schwarzmarkt und dem globalen Markt gibt, nachdem die Ausbeutung der Ressourcen juridische und vor allem ethische Gesetze komplett zu ignorieren scheint.
Der Titel der Skulptur 6GB ending bezieht sich auf Frank Stellas Gemälde Six Mile Bottom aus den 1960ern, ein minimalistisches Werk, das sich durch disziplinierte, sich wiederholende Formen auszeichnet. Stellas Gemälde ist ein Kommentar über den zunehmend mechanisierten und entfremdeten Zustand des modernen Lebens, auf das sich der Künstler mit parallelen Linien bezieht, die ein geometrisches Muster bilden, das sowohl das Gefühl endloser Ausbreitung als auch des Zusammenziehens vermittelt.
Die Skulptur Black Market: 6GB ending – aus anorganischem Material gefertigt und mit einer Oberfläche, die an die Lackierung eines Autos erinnert, gleichzeitig aber organischen Formen ähnelt (speziell frühen Organismen und myzelischen Strukturen) – verbindet verschiedene Zeitlichkeiten und Hybridformen gerade durch ihre Materialität. Die ausgestreckten Arme und ihre Verbundenheit vermitteln, ähnlich wie Frank Stellas Gemälde, das Gefühl von Dehnung und Verkleinerung bis zur Unendlichkeit. Die Haltung der Skulptur ist gewollt mehrdeutig. Ihre ausgestreckten Arme können als greifend, wachsend oder bedrohend interpretiert werden. Ist die Gestalt bedrohlich oder offeriert sie eine neue Form der Existenz?
Škufcas Arbeit verkörpert die Ästhetik von Kollaps und die Möglichkeit von Neuerstehung. Sie fordert dazu auf, die Zukunft nicht vorherzusagen, sondern mit der Unsicherheit zu verweilen und zu bedenken, dass in den Ruinen des einen Systems bereits neue, hybride Lebensformen – technologischer, biologischer und wirtschaftlicher Natur – in Erscheinung treten.

Bildinformationen
Jože Tisnikar
Liebe, (LJUBEZEN), 1977, Öl auf Leinwand
Jože Tisnikar (1928–1998) gilt als einer der bedeutendsten slowenischen Maler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist zweifellos der bedeutendste autodidaktische Künstler seiner Generation. Seine Arbeit setzt sich mit den existenziellen Themen Tod und Leben auseinander, die durch ikonografische Bildsprache zum Ausdruck gebracht werden.
Tisnikars einzigartige Vision wurde von seiner intimen Nähe zum Tod geprägt. Viele Jahre lang war er Assistent in der Leichenhalle des Krankenhauses in Slovenj Gradec, wo er täglich mit den physischen und emotionalen Realitäten unserer Sterblichkeit konfrontiert war. Diese Erfahrungen hinterließen tiefe Spuren in seiner Psyche und fanden in seiner Malerei ihren Ausdruck. Tisnikars Arbeiten lassen sich schwer einer künstlerischen Bewegung zuordnen – der slowenische Kunsthistoriker Tomaž Brejc wies sie dem Dunklen Modernismus zu.
Sein Werk ist am stärksten von Bildern der Toten, der Apokalypse und von Delirium geprägt, oft finden sich auch Raben und Grillen als wiederkehrendes Motiv in seiner Malerei, welche die Vorahnung oder die konstante Präsenz des Todes symbolisieren. Das Gemälde Liebe zeigt ein Paar, das sich umarmt, aber – wie bei vielen anderen Gemälden des Künstlers auch – ist das Motiv einer Grille zu sehen, die, obwohl sie sich im Hintergrund befindet, relativ groß und bedrohlich wirkt. Auf symbolischer Ebene kann das Bild so interpretiert werden, dass der Tod stets über die Liebe triumphieren wird bzw. dass die Wahrnehmung unserer eigenen Sterblichkeit die Bedeutung von Liebe unterstreicht und uns Menschen erst zur Liebe befähigt.
Letztendlich verlangt Tisnikars Arbeit eine Konfrontation damit, was es heißt, Mensch zu sein. Seine Bilder beschäftigen sich mit den emotionalen und metaphysischen Grenzen der Existenz. In einer Welt, die sich immer mehr vom Tod distanziert, erzwingt Tisnikar eine direkte Konfrontation – und somit auch eine Auseinandersetzung mit unserer Liebesfähigkeit.

Bildinformationen
Sophie Utikal
I Thought We Had More Time, 2021, Textil
Sophie Utikals Triptychon lässt uns in eine fantasievolle, traumähnliche Welt eintauchen, die von gesichtslosen weiblichen Körpern bevölkert ist. In einer ambivalenten, mitunter auch dystopisch anmutenden Atmosphäre schweben diese Wesen durch das sie umgebende Wasser, das sie in einem gemeinsamen Schicksal und einer gemeinsamen Verantwortung verbindet. Einer Verantwortung für eine sich verändernde und bedrohte Welt.
Utikals bunte Patchworks aus Stofffragmenten greifen die Tradition der arpillera auf, die sie von der südamerikanischen Familie ihrer Mutter kennt, und lassen sich als erweiterte Selbstporträts lesen. Die Künstlerin geht in ihren Arbeiten von ihrem eigenen Körper aus, geht aber über ihr eigenes Ich hinaus und verhandelt gesellschaftliche Themen wie Migrationserfahrungen, multiple Zugehörigkeiten und daraus resultierende Widersprüche. In ihren Werken verwandelt sie Spuren sozialer Verletzungen und Einsamkeit in selbstbewusste und selbstermächtigende Bilder. Die zunächst einzeln entstehenden Bildelemente näht sie mit groben Stichen zusammen, fügt sie im konkreten wie übertragenen Sinn mit schwarzem Garn aneinander.
In den letzten Jahren beschäftigt sie vor allem die gemeinsame Verantwortung für unseren Planeten. In einer poetischen, symbolischen Bildsprache entwickelt sie in I Thought We Had More Time ein Zukunftsszenario, in dem sie auf die schon lange bekannten, aber erst seit Kurzem im kollektiven Bewusstsein verankerten Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels reagiert: das Schmelzen der Gletscher, extreme Trockenheit oder Niederschläge, die Vergiftung der Meere oder das Artensterben. Sie adressiert Praktiken der Fürsorge und entwirft imaginäre Transformationen des Lebens hin zu einer Koexistenz zwischen den Spezies. Aus der Perspektive von Women of Colour beleuchtet sie Konzepte des Miteinanders und der Resilienz in Zeiten der Klima- und anderer Katastrophen.
Nicht zuletzt erinnert sie mit dem Triptychon daran, dass die Zeit der menschlichen Spezies in dieser Form vergehen wird. Angesichts der Klimakatastrophe wird immer deutlicher, dass in allen – auch im Leben und Werk von Utikal präsenten und alles andere als nebensächlichen – Fragen sozialer Diskriminierungen immer auch die existenzielle Frage des biologischen Überlebens mitgedacht werden muss. Deren Bewältigung wird viel radikalere Veränderungen erfordern, als wir uns bisher vorstellen können.

Bildinformationen
Bill Viola
The Raft, 2004, Video- und Klanginstallation
Bill Viola (1951–2024) war ein amerikanischer Videokünstler, der sich intensiv mit Fragen rund um das menschliche Dasein befasste und sich mit essenziellen Themen der menschlichen Existenz wie Leben, Geburt und Vergänglichkeit auseinandersetzte. Er gehörte einer Generation von Künstlern an, die in den frühen 70ern begann, Video nicht nur als Dokumentationsmedium, sondern als neue Ausdrucksform für Ideen zu sehen. Die Bandbreite seines Werkes reicht von Videos bis zu räumlichen Installationen und Objekten.
Seine Videoinstallationen – oft großflächig, langsam und äußerst emotional – laden die Betrachter*innen in einen meditativen Raum ein. In seinen Videos finden sich oft Referenzen zu ikonischen Kunstwerken, historischen Fresken und Gemälden. Eine der größten Inspirationsquellen war Michelangelo, dessen Einfluss in der spezifischen ästhetischen Sprache zu erkennen ist, die Viola eigen war. Das Verlangsamen der Videos, das so oft zu sehen ist, wirkt wie ein untersuchendes Objektiv, das es uns ermöglicht, genauer zu beobachten, wie menschliche Emotionen zum Ausdruck gebracht, verarbeitet und transzendiert werden – und wie sie auf zeitbasierte Medien übertragen werden.
Violas Werk hat auch außerhalb der Kunstwelt Anklang gefunden; so schuf er das Video The Raft für die Olympischen Spiele in Griechenland im Jahr 2004. Das Video wurde nach dem berühmten Gemälde von Théodore Géricault, Das Floß der Medusa (1818–1819), einem der wichtigsten Werke der französischen Romantik, benannt. Das riesige Bild (490 × 716 cm) zeigt ein Floß, auf das sich Menschen nach dem Schiffbruch der Medusa vor der marokkanischen Küste im Jahr 1816 gerettet hatten, von denen aber nur eine Handvoll überleben sollten.
Wie der Titel The Raft (dt. Das Floß) suggeriert, ist das oben genannte Gemälde eine Referenz für Violas Werk. Letzteres zeigt eine Gruppe von Menschen, die von einem starken Wasserstrahl überrascht werden, der von allen Seiten auf sie einströmt. So wie das Wasser die stehenden Menschen ohne Warnung trifft, zieht es sich nach einiger Zeit ebenso unvermittelt wieder zurück und diejenigen, die vom Wasser umgestoßen wurden, versuchen wieder aufzustehen. Es sieht so aus, als hätte das Wasser alle Klassenunterschiede, die zuvor durch die Kleidung der Menschen noch erkennbar waren, weggewaschen. Alle sind gleichermaßen geschockt und versuchen einander zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen.
Es ist ein Werk, das die zeitgenössische Situation reflektiert, in der uns konstant Katastrophen drohen. Gleichzeitig erzählt es aber auch vom großen Vertrauen in die Menschheit und deren Widerstandskraft.

Bildinformationen
zweintopf
2406079: Road to Nowhere, 2012/2025, Fototapete
Eine Straße ins Nirgendwo: ein Klischee par excellence. Ein wolkenloser blauer Himmel über der schnurgeraden Straße, Unendlichkeit, Freiheit sind eine mediale Ikone, unzählige Male reproduziert in Filmen, Fernsehen und Werbung. Vor allem Autos werden oft mit diesem Motiv beworben, stehen sie in unserer individualistisch geprägten Konsumgesellschaft doch für Freiheit wie kaum ein anderes Objekt. Obwohl die meisten Autos selten die unendliche Landstraße entlangfahren, sondern die meiste Zeit ihrer Existenz auf einem Parkplatz stehen oder in einem Parkhaus auf eine nackte Betonwand schauen. Wo sie dank zweintopf – zumindest temporär – auf ihren Sehnsuchtsort treffen konnten.
Das Künstler*innenduo zweintopf, 2006 von Eva Pichler und Gerhard Pichler gegründet, arbeitet gleichermaßen künstlerisch und kuratorisch in klassischen Ausstellungskontexten sowie in (meist unangekündigten) ortsspezifischen Kunstinterventionen im öffentlichen Raum. Dabei beschäftigen sie sich in unterschiedlichen Medien und konzeptuellen Arbeiten mit gesellschaftspolitischen Themen rund um Konsum, öffentlichen Raum und Urbanität und deren immanenten alltäglichen Absurditäten. Deren Codes und Symbolik mit scharfem Beobachtungssinn zu entdecken, zu verdichten und mit einer dem Duo eigenen Poesie der trivialen Dinge in Kunstinterventionen oder -werke zu verwandeln, ist der Kern der künstlerischen Arbeit von zweintopf.
So haben sie auch den automobilen (oder eben auto-nicht-mobilen) Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit aufgegriffen. 2406079 ist die Produktnummer einer Fototapete, die im Internet erhältlich ist – der Sehnsuchtsort von der Stange. zweintopf hat diese für private Wohnzimmer gedachte Tapete als Tromp-l’œil in das Parkhaus eines Grazer Einkaufszentrums transferiert. Von einem Parkplatz führte nun, in der exakten Verlängerung der Bodenmarkierungen, eine standardisierte Straße ins Nirgendwo der Betonwand. Die Guerilla-Tapezieraktion wurde in einem Video und fotografisch festgehalten.
Für das Kunsthaus Graz druckte zweintopf das Foto der vollendeten Aktion nun wiederum als Fototapete, multipliziert in einem theoretisch beliebig fortsetzbaren Spiel mit dem „visuellen Verräumlichungsinstrument Tapete“ (zweintopf) die einfach zu durchschauende Täuschung und lässt die Road to Nowhere den Travelator fortsetzen, der aus dem urbanen Foyer in die Ausstellungsräume führt.