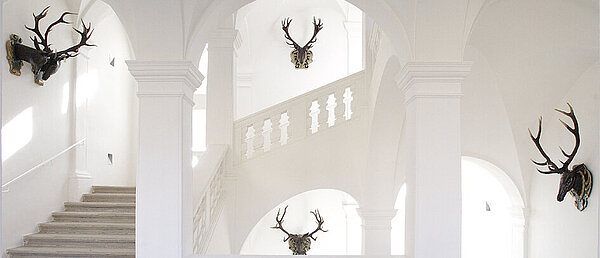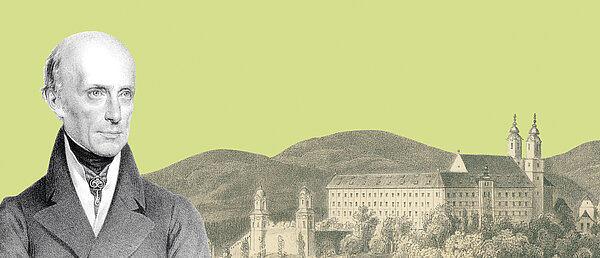Das Jagdmuseum in Schloss Stainz wird eröffnet. Heute ist die Jagdkundliche Sammlung am Universalmuseum Joanneum die größte ihrer Art in ganz Österreich.

Museen in Schloss Stainz Das Jagdmuseum präsentiert die facettenreiche Kulturgeschichte der Jagd und spannendes Naturwissen. Das Landwirtschaftsmuseum zeigt die Entwicklung land- und forstwirtschaftlicher Arbeit von vorindustrieller Zeit bis heute. Das Erzherzog Johann Museum ist den fortschrittlichen Initiativen und dem bewegten Leben Erzherzog Johanns gewidmet.
2006
2009
Die Ausstellung des Landwirtschaftsmuseums wird neu konzipiert. Im Fokus steht die Entwicklung der steirischen Land- und Forstwirtschaft.
2024
Mit der Eröffnung des neuen Erzherzog Johann Museums in Schloss Stainz wird das Universalmuseum Joanneum um ein weiteres Museum reicher, das sich auf rund 650 m² Ausstellungsfläche mit dem Leben und Wirken seines Stifters auseinandersetzt.
Aktuelle Programmhighlights

Genussreise in Stainz
Auf den Spuren von Erzherzog Johann
Diese Genussreise führt Sie über den Erzherzog-Johann-Weg durch einen Ort voller Geschichte, Tradition und eindrucksvoller Schauplätze.
Jeden letzten Freitag im Monat.
Aktionstag
Ferienspaß im Museum
Ein Tag in den und rund um die Museen in Schloss Stainz
Museen in Schloss Stainz
23.07.2025
Veranstaltung

Sommerwochen
Ein Prinz in der Steiermark?
Erzherzog Johann Museum Schloss Stainz
05.08. - 08.08.2025
Kinderprogramm

Klub für Frechdachse
Abenteuer im Museum
Museen Schloss Stainz
Termine: 16.4., 17.4., 2.5., 30.5., 20.6., 16.7., 29.10., 30.10., 8.11., 29.11.2025
Fixführung
Fixführung Museen in Schloss Stainz
Jagdmuseum oder Landwirtschaftsmuseum oder Erzherzog Johann Museum
Dienstag-Freitag sowie Sonntag jeweils um 15:00
Familienführung
Unterwegs mit Johann, Anna und Franz
Familienführung im Erzherzog Johann Museum
Erzherzog Johann Museum Schloss Stainz
Jeden Samstag von 15:00 - 16:30 Uhr
Ihre persönlichen Servicestellen
Die Servicestellen des Jagdmuseums und des Landwirtschaftsmuseums Schloss Stainz mit ihren Sammlungs- und Arbeitsstätten stehen das ganze Jahr über für Anfragen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bildinformationen