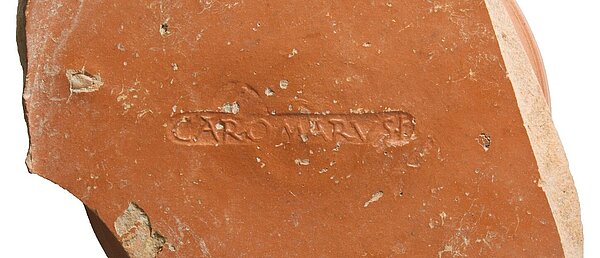Flavia Solva zählte zu den kultiviertesten Städten der römischen Provinz Noricum und ist der bedeutendste römerzeitliche Fundplatz des Landes. Exponate aus über 140 Jahren archäologischer Forschung vermitteln antikes Lebensgefühl am Originalschauplatz!
Entdecke das
Universalmuseum Joanneum
Graz
Steiermark
Universalmuseum
Joanneum
Zurück zum Universalmuseum Joanneum
Flavia Solva > Unser Programm > Ausstellung