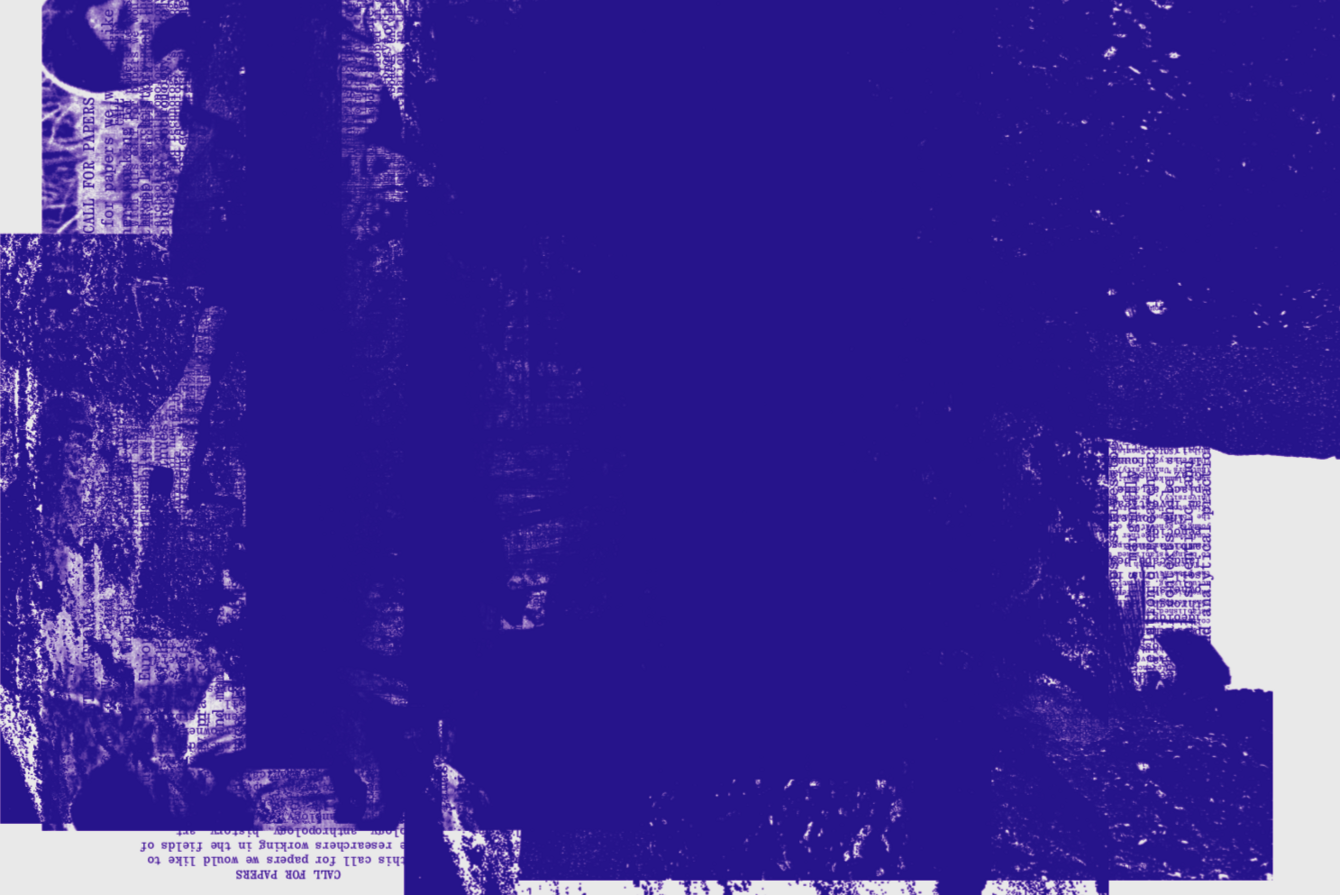Es ist sehr wichtig, den Zweiten Weltkrieg und die Zeit des Nationalsozialismus als Periode zu betrachten, in der sich einst koloniale Praktiken auf dem europäischen Kontinent durchzusetzen begannen. Diese Praktiken, die sich über ganze Territorien ausbreiteten und zuvor auf den kolonialen Kontext beschränkt waren, prägen auch weiterhin unsere Vorstellungen von Spezies, Rasse und Geschlecht und durchdringen unsere Verhaltensweisen, Institutionen und Vorstellungen bis in die Gegenwart. Ausgehend von der vielschichtigen und vielfältigen Handlungsmacht des Bodens will die Konferenz „Das Leben der Feldfrüchte“ die Einschreibung von Krieg und Arbeit aus der Erde heraus aufdecken, beginnend mit der verdrängten Geschichte des Konzentrations- und Arbeitslagers Aflenz an der Sulm im Süden Österreichs (1944–1945). Durch den Einsatz postprozessualer Archäologie und einer Vielzahl von Analysen und Herangehensweisen offenbart sich der Boden als Akteur beim Aufbau ideologischer Hierarchien von Klasse und Rasse durch die Beziehungen zwischen Arbeit und Eigentum. Einer taxonomischen Abflachung entgegenwirkend, wendet sich die Konferenz dem Boden als lebendigem Archiv zu – einer Landschaft, die alle Ebenen der Gewalt in sich trägt.
Das Leben der Feldfrüchte: Towards an Investigative Memorialization ist der grundlegende Baustein des kollaborativen Projektes „Aflenz Memorial in Becoming“, initiiert von der Künstlerin Milica Tomić, das Memorialisierung als eine investigative und antikommemorative Praxis des Neuaufbaus, der Aktualisierung und Aktivierung von Wissen in der Gegenwart betrachtet. Die investigative Konferenz versammelt 22 international renommierte Autor*innen aus den Bereichen Psychoanalyse, Philosophie, Kulturtheorie und Feminismus sowie Archäologie, Geschichte, Architekturtheorie, Kunst und Aktivismus, um wichtige aktuelle Fragestellungen wie Krieg und Kapital, (Neo-)Kolonialismus, Eigentum und Ausbeutung, Migration und Arbeitsverhältnisse, Umwelt, Geschlecht und Klassengerechtigkeit zu diskutieren und gemeinsam zu bearbeiten.
An der Konferenz nehmen Denker*innen teil, die in ihrer Arbeit die Grenzen und die im Zentrum ihrer Disziplinen existierende epistemische Gewalt erfassen, vor allem aus Disziplinen, deren Wissen für die Entfaltung des „räumlichen Ereignisses“ und seiner Resonanzen entscheidend ist: Im Verstehen von Krieg als integrales Instrument des Kapitals (Alliez) sieht die Konferenz „Das Leben der Feldfrüchte“ Privatisierung und Eigentum als juristisches Konzept im Kolonialismus (Bhandar) als entscheidend für die rassische Diskriminierungsfähigkeit des Kapitalismus (Herscher) und den Nationalsozialismus als Versuch absoluter Privatisierung (Stojanović). Die Konferenz untersucht, wie „neutralisierte“ Konzepte wie Kultivierung (Bhandar), Bepflanzung (Binboğa) und Expertise (Çaylı und Malterre-Barthes) genutzt werden, um nicht nur Körper, Natur und Land, sondern auch das Imaginäre (Malcomess) und die Wahrnehmung (Peraica) weiter zu umgreifen. Das Konzept von Eigentum, welches die lebendigen Objekte Land und Boden in eine Abstraktion verwandelt, erzeugt eine neue Art von Subjektivität, die durch die Befähigung definiert ist, nicht nur das Land und das, was darauf wächst und gedeiht, zu besitzen, sondern auch diejenigen, die es bearbeiten (Coelho). Mit dem Aufkommen der Figur des Arbeiters als jemand, der nichts besitzt, können Freiheit und Arbeitskraft nicht vom Begriff der Sklaverei getrennt werden, der die Organisation von Arbeit bis zum heutigen Tag kontinuierlich prägt (Perz, doplgenger, Ferrini). Die versengte Erde (Kehar) und die nackten Knochen (Bago) – vom Kapital stumm geschaltet und zeitlich aufgelöst – sind nicht ohne Vergangenheit und Zukunft, ebenso wenig wie ohne eigene Wissensformen.
Durch die Weigerung, zu dem vom Kapital definierten „Normativen“ zurückzukehren, können sowohl die Ruine (Sadek) als auch die Wüste (El Baroni) anstatt in ihrem Versagen, produktiv zu sein, als weltenbildende Realitäten wahrgenommen werden, in denen die epistemische Gewalt des Kapitals anerkannt und konterkariert wird. Dies bedeutet auch, die Arbeit nichtanthropogener Faktoren anzuerkennen, wie etwa die Handlungsmacht des Bodens zur Instandhaltung und Rekonstruktion (Reisinger). Während der Boden eine wichtige Rolle bei der Konstruktion faschistischer und kolonialistischer Narrative und Vorstellungen spielt, können einschließende Techniken wie Agronomie oder Saatguttechnik zu Instrumenten des antikolonialen Kampfes (César) und Träger von Erinnerung und Widerstand (Sheikh) werden, gerade aufgrund ihrer Fähigkeit, ein Gegengedächtnis des Bodens (González-Ruibal) zu aktivieren. Wenn man sich in Richtung eines antikapitalistischen und antikolonialen Horizonts bewegt, kann selbst die Kultivierung (Black) und das Eigentum (Stojanović) zu gerechten Welten führen.
Eine Konferenz mit Éric Alliez / Ivana Bago / Bassam El Baroni / Brenna Bhandar / Seçil Binboğa / Virginia Black / Eray Çaylı / Filipa César / Rui Gomes Coelho / doplgenger / Alessandra Ferrini / Andrew Herscher / Alfredo Gonzalez-Ruibal / Anne Historical / Anousheh Kehar / Charlotte Malterre-Barthes / Ana Peraica / Bertrand Perz / Karin Reisinger / Walid Sadek / Shela Sheikh / Branimir Stojanović
Ehrengast: Franz Trampusch
Die zweitägige Konferenz entsteht in Zusammenarbeit mit: KIÖR – Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, Universalmuseum Joanneum; Gemeinde Wagna; Retzhof – Bildungshaus des Landes Steiermark; IZK – Institut für Zeitgenössische Kunst, Fakultät für Architektur, Technische Universität Graz; Tabakalera – International Centre for Contemporary Culture und COOP EB - Verein zur Förderung nationaler und internationaler Kooperationen im Bereich der Erwachsenenbildung. Mit finanzieller Unterstützung des Zukunftsfonds der Republik Österreich sowie des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus.