4. Juni 2015 / Theresa Wakonig
„Als hätte eine Plastikbombe eingeschlagen“

Kuratorin Angeli Sachs in der Ausstellung “Endstation Meer”, Foto: Universalmuseum Joanneum/N. Lackner
Mein Direktor hat 2009 einen Artikel im Folio der NZZ gelesen: Eine Ahnung von Apokalypse. Er war erschüttert davon und hat in der Programmkommission darüber berichtet. Wir haben das Thema diskutiert und beschlossen, eine Ausstellung darüber dazu machen. Die Grundidee war eine große Installation aus Plastik-Schwemmgut. Ich habe angefangen, ein Konzept um diese Grundidee herum zu entwickeln und diese in einen größeren Kontext einzubetten.
Mit der Drosos Stiftung konnten wir einen tollen Sponsorenpartner gewinnen. Vom integrierten Vermittlungskonzept, das wir für sie entwickelten, waren sie so begeistert, dass sie sich sehr engagierten und jetzt auch die Tournee unterstützen. Schließlich nahm das Projekt enorme Dimensionen an: Wir hatten plötzlich eine ganze Abteilung. Direktor Christian Brändle kam als zweiter Kurator mit an Bord, wir hatten mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter, eine ganze Vermittlungsabteilung und vieles mehr. Das war dann auch notwendig, da wir ja auch von Anfang an die Tournee mitbedacht haben.
Im ersten Teil der Ausstellung sieht man Berge von Plastikmüll. Wie schaffte man es, diese anzuschaffen?
Wir haben nach Kooperationspartnern Ausschau gehalten. Eine Tauchervereinigung unterstützte uns bei der Suche nach NGOs und Aktivistengruppen, die Plastikmüll sammeln. Auf den Aufruf meldete sich eine Gruppe aus Hawaii, die einmal im Jahr die unbewohnte Insel Kaho‘olawe reinigt. Dort häuft sich unglaublich viel Plastikmüll an, da nämlich aus dem großen pazifischen Plastikmüllstrudel Teile ausgeschieden und an die Küsten geschwemmt werden. Die Gruppe sammelt auf Kaho’olawe jedes Jahr Berge an Müll. Sie meinten: „Schickt uns einfach einen Container und wir packen euch den voll.“ Das taten sie dann auch.
Also sind die Objekte in der Ausstellung wirklich so, wie sie am Strand liegen, ohne jegliche Aufbereitung oder Veränderung?
Ja. Natürlich achtete die Gruppe darauf, den Müll trocken einzupacken. Wir waren immer ein bisschen besorgt, was uns da erwartet, wenn wir nach vielen Monaten den Container in Zürich öffnen. Aber die Gruppe besteht aus richtigen Profis, sie haben das sehr gut gemacht. Außerdem kooperierten wir auch mit einer Containerfirma, die uns in der Logistik unterstützte. Sie schickte den Container nach Hawaii. Voll bepackt kam er dann eines Tages in Zürich an. Das ist übrigens auch jener Container, in dem die Ausstellung jetzt weiterreist und auch nach Graz gebracht wurde.
Aus Hawaii wurde der allergrößte Teil des Plastikmülls geliefert. Zusätzlich gab es zwei Sammelaktionen in Deutschland. Bei beiden war ich dabei. Ich wollte sehen, wie diese Dinge gemacht werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich finde es wichtig, dass man da nicht nur aus der Ferne draufschaut.
Was soll die Plastik-Installation bei den Besucherinnen und Besuchern auslösen?
In Zürich war es so: Die Besucherinnen und Besucher kamen rein, haben gestaunt, und dann klappte ihnen eigentlich der Kinnladen runter! Das war wirklich ein Wow-Effekt. Also beeindruckend und erschreckend zugleich.
Der größte Teil des Plastiks kommt aus Ländern wie China und Indien ins Meer. Wie wichtig ist es trotzdem, auch in Europa ein Bewusstsein dafür zu schaffen?
Wir Europäer sind selbst ganz kräftig an dem Problem beteiligt. Ich würde niemals wagen, dieses Problem auf China, Indien oder in andere Schwellenländer abzuschieben. Die Verpackungsindustrie ist ein Phänomen der Industriestaaten und einer Wohlstandsgesellschaft. Sehen wir uns doch zum Beispiel Feiern im Freien an: Wenn in Zürich wieder so ein Wochenende war, wo die Leute in den Parkanlagen durchgefeiert haben, dann sieht die Stadt aus, als hätte eine Plastikbombe eingeschlagen. Natürlich gelangt davon auch etwas in die Flüsse und den See. Am Ende landet es im Meer.
Welche Tipps gibt die Ausstellung, um Plastikmüll zu vermeiden?
Die Ausstellung möchte die Besucherinnen und Besucher zur Selbstreflexion anregen. Wie können wir Plastiktüten vermeiden? Wie können wir Lebensmittelverpackungen zumindest nur reduziert zum Einsatz bringen? Wie gehen wir mit Fast-Food um? Können wir wiederverwendbare Gegenstände verwenden, um uns Essen zu holen? Haben wir einen zusammenfaltbaren „Shopper“ dabei – ein kleines Netz, um unsere Einkäufe zu verstauen, damit wir nicht in jedem Geschäft eine Plastiktüte mitnehmen? Welche Materialien kaufen wir, welche kaufen wir nicht? Wie achten wir auf die Zusatzstoffe? Da gibt es ganz viel, was wir tun können. Deshalb haben wir auch extra den Teil „Plastik im Alltag“ entwickelt.
Die Ausstellung soll doch sicher auch zur aktiven Verbesserung anregen, oder?
Sie hat sicherlich einen stärker didaktischen Anspruch als manche andere Ausstellungen, die wir entwickelt haben. Aber sie soll das nicht mit der Keule tun. Es soll jedem Besucher und jeder Besucherin selbst überlassen sein, wie er oder sie sich da positionieren möchte: Was kann man in den Alltag integrieren? Wo ist man gewillt, etwas zu ändern? Vielleicht bemerken die Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung problematische Dinge überhaupt das erste Mal und entwickeln so eine gewisse Achtsamkeit.
Versuchen Sie eigentlich auch, Plastik in Ihrem Alltag zu vermeiden?
Ich persönlich hatte nie eine große Affinität zu Plastik. Ich mag natürliche Stoffe lieber. Beim Kochen verwende ich auch lieber Edelstahl – weil ich es hygienischer finde. Gerade aus meiner Küche ist von dem Plastik, das ich hatte, sehr viel verschwunden. Während ich an den „Plastik im Alltag“-Texten schrieb, ging ich ab und zu in mein Haus und entfernte wieder einen Teil (lacht). Das landete dann in unserem großen Demonstrationsaquarium für den persönlichen Verbrauch. Ich verwende keine Fleece-Decken, um mich zuzudecken. Da suche ich einfach nach anderen Stoffen. Vieles lässt sich ersetzen. Es sind zwar nicht immer die preiswerteren Alternativen, aber im Konsum ist meiner Ansicht nach ohnehin „weniger und besser“ statt „mehr und billig“ angesagt.
Angeli Sachs ist Leiterin des Studiengangs „Master of Arts in Art Education“ und der Vertiefung „ausstellen & vermitteln“ an der Zürcher Hochschule der Künste sowie Kuratorin am Museum für Gestaltung Zürich. Sie hat Kunstgeschichte, Germanistik und Soziologie an den Universitäten von Augsburg und Frankfurt am Main studiert.
Schlagworte: Interview


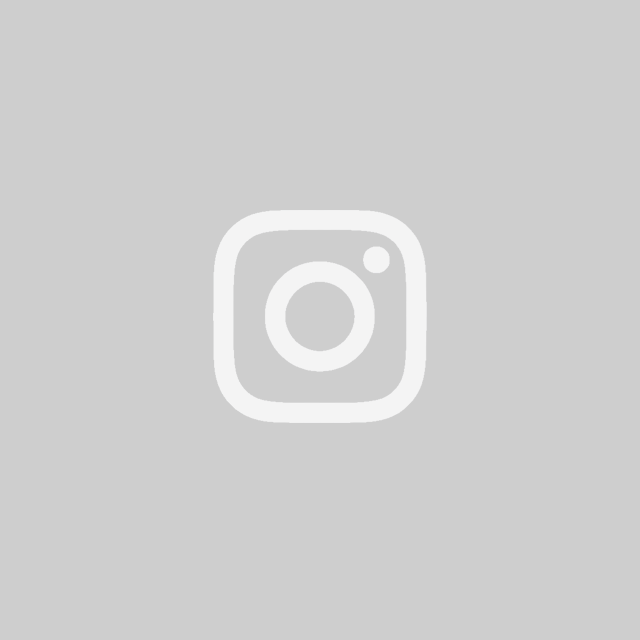

Lesestoff: Gulasch, Müll, Klimarahmen und Röntgenblicke
[…] “Als hätte eine Plastikbombe eingeschlagen” […]